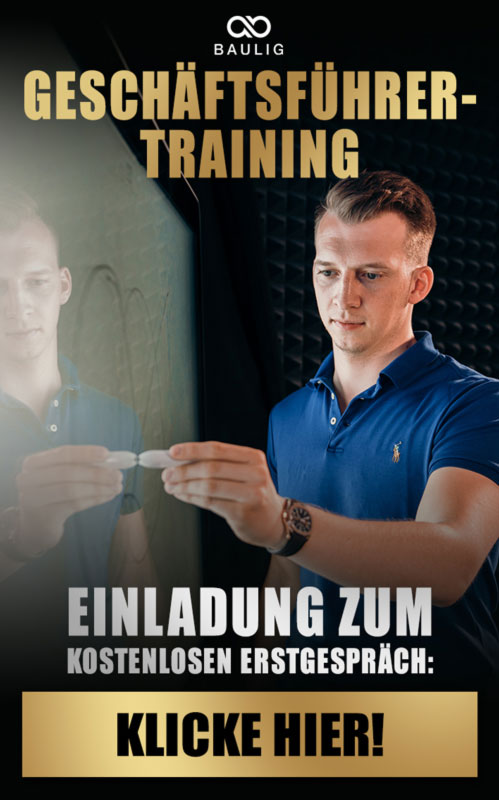Ticker
Deutschland verschärft Kampf gegen Hawala-System – informelle Geldflüsse im Visier von Zoll und BaFin

Als Zollbeamte vergangenes Jahr einen Lkw-Fahrer an einer bayerischen Raststätte kontrollierten, fanden sie zwei Plastiktüten voller Bargeld – insgesamt mehrere hunderttausend Euro. Der Fahrer erklärte, das Geld sei für Erdbebenopfer in der Türkei bestimmt. Er habe weder die Spender gekannt noch gewusst, warum sie ihm 10.000 Euro für Diesel und Verpflegung mitgegeben hätten. Für deutsche Behörden war der Fall klar: Ein Kurier im Dienst des Hawala-Systems.
Hawala, ein informelles Zahlungsnetzwerk mit jahrhundertealten Wurzeln, wird zunehmend zum Ziel deutscher Ermittler. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Zoll und das Bundeskriminalamt sehen in dem System eine wachsende Gefahr für die Integrität des Finanzstandorts Deutschland – insbesondere angesichts des gestiegenen Missbrauchs für Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Schleuseraktivitäten.
In Deutschland ist Hawala illegal, anders als etwa in Großbritannien oder den USA, wo regulierte Ausnahmen existieren. Das Grundprinzip bleibt gleich: Bargeld wird einem Mittelsmann, dem sogenannten hawaladar, übergeben – etwa dem Betreiber eines Handyladens. Der Empfänger im Ausland erhält über einen zweiten hawaladar den Betrag, meist gegen Vorlage eines Codes. Die Buchhaltung erfolgt später durch Ausgleichstransfers oder Warensendungen. Die Transaktionen sind anonym, schnell – und außerhalb jeder behördlichen Kontrolle.
Laut BaFin-Expertin Birgit Rodolphe liegt das über Hawala abgewickelte globale Transfervolumen bei rund 200 Milliarden Dollar jährlich. In Deutschland verdichten sich Hinweise, dass das System nicht nur von Geflüchteten oder Migranten genutzt wird, die keine Bankverbindung haben, sondern zunehmend auch von professionellen Netzwerken, die Menschenhandel und organisierte Kriminalität finanzieren. In einem Fall aus Düsseldorf wurden fünf Männer verurteilt, die über 150 Millionen Euro bewegt und dabei Provisionen in Millionenhöhe eingenommen hatten.
Die jüngste Maßnahme der Behörden zielt auf das regulierte Finanzsystem: Banken wurden mit einem vertraulichen Merkblatt ausgestattet, das typische Warnsignale für hawalabasierte Aktivitäten beschreibt – etwa, wenn Hypotheken durch Dritte getilgt oder größere Bargeldsummen ohne klaren Verwendungszweck bewegt werden. Auch der Handel mit Luxusgütern, Kryptowährungen oder Prepaid-Karten rückt in den Fokus.
Gleichzeitig wächst der politische Druck. Deutschland zählt zu den fünf Ländern mit den meisten Geflüchteten weltweit. Vor diesem Hintergrund steigt auch die Nachfrage nach informellen Geldtransferdiensten – insbesondere für Zahlungen in sanktionierte oder instabile Staaten wie Syrien, Afghanistan oder Iran, wo herkömmliche Finanzinfrastruktur oft nicht verfügbar ist.
Während einzelne Hilfsorganisationen in Ausnahmefällen selbst auf Hawala zurückgreifen, verweisen Behörden auf strukturelle Risiken. Rodolphe sagt: „Die Länder, in die kaum Geld über Banken fließt, sind fast immer Hochrisikostaaten. Es hat einen Grund, warum etablierte Zahlungsdienstleister sich dort zurückgezogen haben.“
Das bleibt ein Dilemma: Für viele Menschen ist Hawala ein unverzichtbares Mittel zur Versorgung von Angehörigen – für Kriminelle ein ideales System zur Verschleierung ihrer Geldströme.
Bei Nachrichten von Eulerpool handelt es sich um extern erstellte Tickermeldungen. Ihre Einbettung erfolgt automatisch. Sie werden von uns nicht überprüft oder bearbeitet.