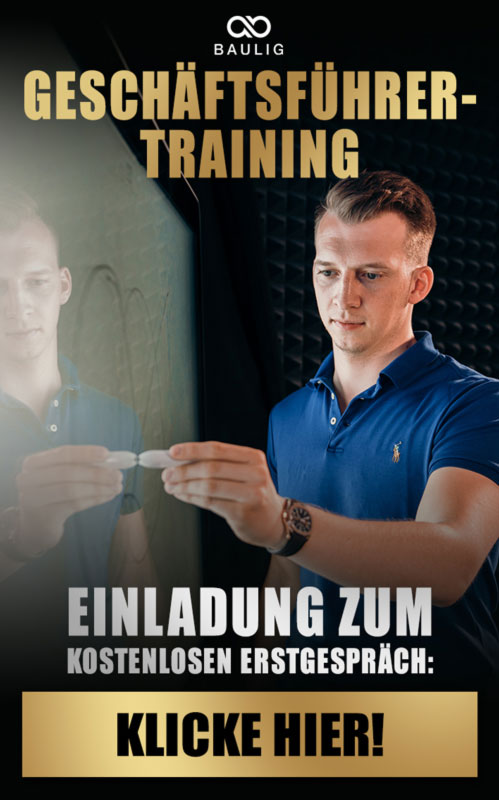Ticker
Trump blockiert China – und die Welt bekommt die Rechnung

Mit seiner „Liberation Day“-Initiative hat US-Präsident Donald Trump einen massiven Schwenk in der globalen Handelspolitik ausgelöst. Im Mittelpunkt steht eine neue Zollstruktur, die chinesische Importe mit durchschnittlich 70 % belegt – ein historisch beispielloser Wert. Produkte von Elektronik über Spielwaren bis zu industriellen Komponenten werden dadurch für US-Käufer spürbar teurer. Doch die direkten Auswirkungen auf amerikanische Verbraucher und Unternehmen sind nur ein Teil des Problems.
Denn was nicht mehr in die USA geliefert wird, muss andere Absatzmärkte finden. Rund 440 Milliarden Dollar chinesischer Exporte waren 2024 für den US-Markt bestimmt – ein Volumen, das sich nicht ohne Weiteres umlenken lässt. Die Befürchtung: Chinas überschüssige Produktion könnte internationale Märkte fluten und dort für Verwerfungen sorgen, die das Handelsklima weiter destabilisieren.
Bereits in den vergangenen Jahren waren Chinas Überkapazitäten international umstritten. Seit Beginn von Trumps Handelskrieg im Jahr 2018 wurden laut Global Trade Alert fast 500 Antidumping-Verfahren gegen chinesische Produkte angestrengt. Allein 2023 reagierten Brasilien, Mexiko, Kanada, das Vereinigte Königreich und die EU mit Importbeschränkungen oder Strafzöllen auf einen wachsenden Strom günstiger Industrieexporte aus der Volksrepublik.
Die Eskalation aus Washington könnte diesen Trend beschleunigen. Wirtschaftswissenschaftler wie Brad Setser vom Council on Foreign Relations warnen, dass es „keine anderen großen Märkte gibt, die Chinas Produktionsvolumen auffangen können“. Die Folge wäre eine neue China-Schockwelle – diesmal nicht ausgelöst durch Innovation, sondern durch Verdrängung.
Beijing steckt derweil in einem strukturellen Dilemma. Investitionen in den Wohnungsbau stagnieren, der Konsum bleibt schwach, und die Regierung versucht, das Wachstum mit massiver Industrieproduktion zu stabilisieren. Ökonomen wie Yu Xiangrong von Citi rechnen damit, dass Trumps Zölle das chinesische BIP um bis zu einen Prozentpunkt drücken könnten. Um dem entgegenzuwirken, müsste Peking zusätzliche Konjunkturmaßnahmen ergreifen – von Zinssenkungen über neue Staatsausgaben bis hin zu direkten Stimulanzien für die Verbraucher.
Die chinesische Regierung kündigte am Donnerstag „entschlossene Gegenmaßnahmen“ an, nannte aber keine Details. Frühere Reaktionen auf US-Zölle umfassten 15 %-Abgaben auf Agrargüter wie Huhn, Weizen und Baumwolle sowie die Aufnahme amerikanischer Unternehmen in schwarze Listen. Das chinesische Handelsministerium erklärte: „Die Geschichte hat gezeigt, dass Zölle keine Probleme lösen – sie schaden den USA und der Weltwirtschaft.“
Die USA treffen mit ihrer Maßnahme jedoch nicht nur China. Auch Länder wie Japan, Südkorea, Vietnam und die EU sind betroffen. Während China mit einem Aufschlag von 34 % sanktioniert wird, gilt für alle Importe ab 5. April ein pauschaler Zollsatz von 10 %. Einzelne Länder, darunter die EU, müssen mit zusätzlichen „reziproken“ Zöllen rechnen – je nach ihrer Handelspolitik gegenüber den USA.
Ökonomen wie Michael Pettis von der Universität Peking gehen davon aus, dass die wahren Folgen erst noch bevorstehen. Die bisherigen Maßnahmen könnten sich rasch zu einer globalen Kettenreaktion entwickeln – mit Exportverlagerungen, Retorsionsmaßnahmen und wachsendem Protektionismus. Schon jetzt zeigt sich: Trumps Zollpolitik mag innenpolitisch als Machtdemonstration gedacht sein – ökonomisch ist sie ein Exportproblem. Nur diesmal nicht für China allein.
Bei Nachrichten von Eulerpool handelt es sich um extern erstellte Tickermeldungen. Ihre Einbettung erfolgt automatisch. Sie werden von uns nicht überprüft oder bearbeitet.